bizFM – online Geld verdienen
Mit diesen Möglichkeiten kannst du online seriös Geld verdienen
bizFM Blog
Du pflegst einen ausgefallenen oder alternativen Lebensstil und möchtest mit diesem gerne einen kleinen Nebenverdienst generieren? Das ist mit dem Umfrageportal listentoyoursenses.com möglich. Dieses etwas anders ...
Du pflegst ein großes Interesse in die Welt der Kinofilme und Fernsehserien und willst online Geld verdienen? Dann, so wirbt der Anbieter, ist Moviepanel genau das ...
Du willst dir seriös im Internet einen Nebenverdienst aufbauen und dabei nicht auf schmuddelige Lockangebote hereinfallen? Dann solltest du definitiv ein Auge auf Prime Opinion werfen. ...
Du willst deine Zeit vor dem Fernseher sinnvoll nutzen und ein bisschen Geld nebenbei verdienen, während die Flimmerkiste läuft? Die Online-Plattform Rewards.de will genau das möglich ...
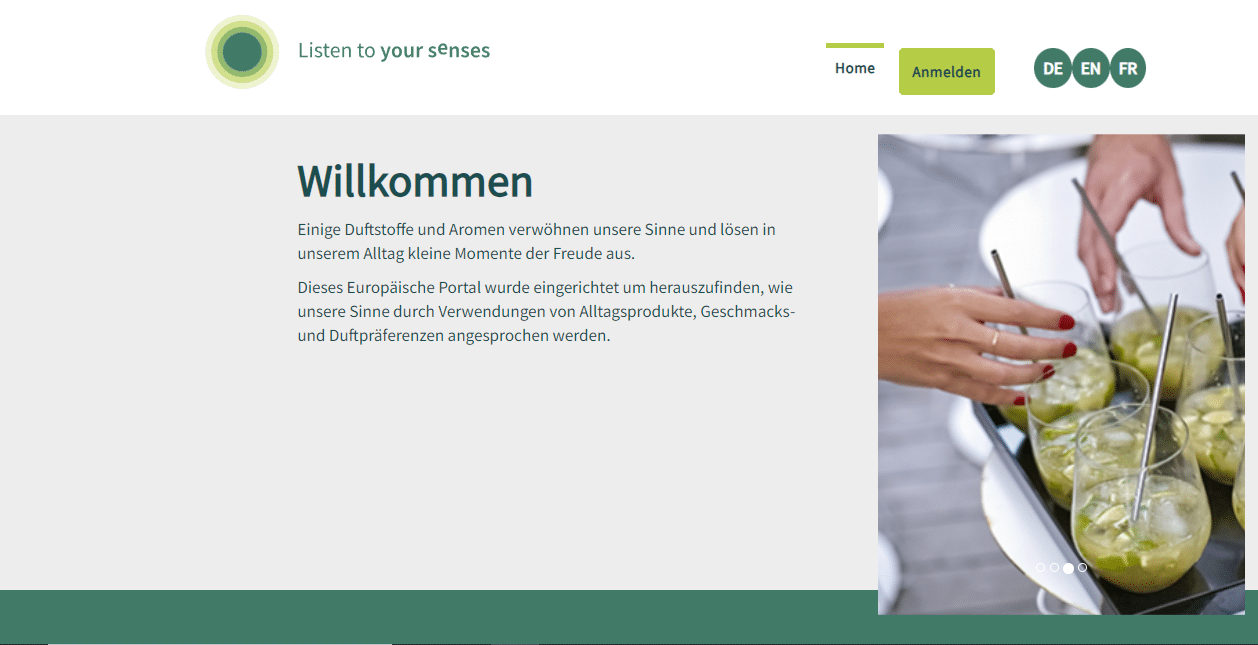
Listentoyoursenses.com im Test: Meine Erfahrungen 2024
Du pflegst einen ausgefallenen oder alternativen Lebensstil und möchtest mit diesem gerne einen kleinen Nebenverdienst generieren? Das ist mit dem Umfrageportal listentoyoursenses.com möglich. Dieses etwas …

Moviepanel Erfahrungen: Das etwas andere Portal überzeugt im Test
Du pflegst ein großes Interesse in die Welt der Kinofilme und Fernsehserien und willst online Geld verdienen? Dann, so wirbt der Anbieter, ist Moviepanel genau …
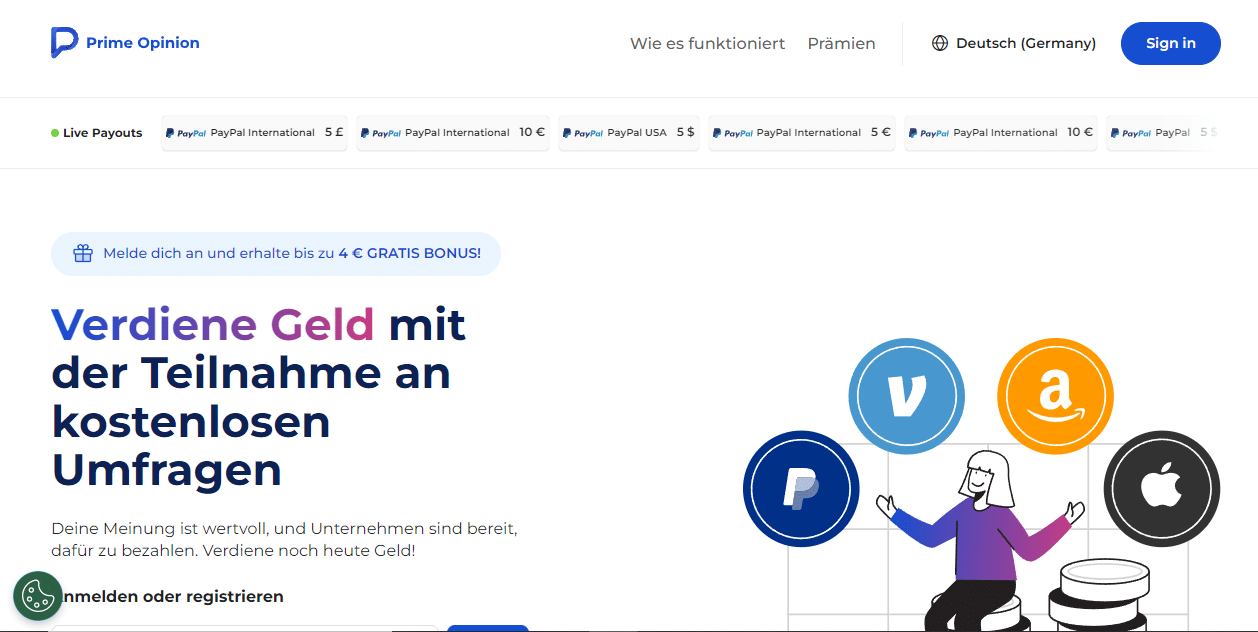
Prime Opinion im Test 2024: Meine Prime Opinion Erfahrungen
Du willst dir seriös im Internet einen Nebenverdienst aufbauen und dabei nicht auf schmuddelige Lockangebote hereinfallen? Dann solltest du definitiv ein Auge auf Prime Opinion …
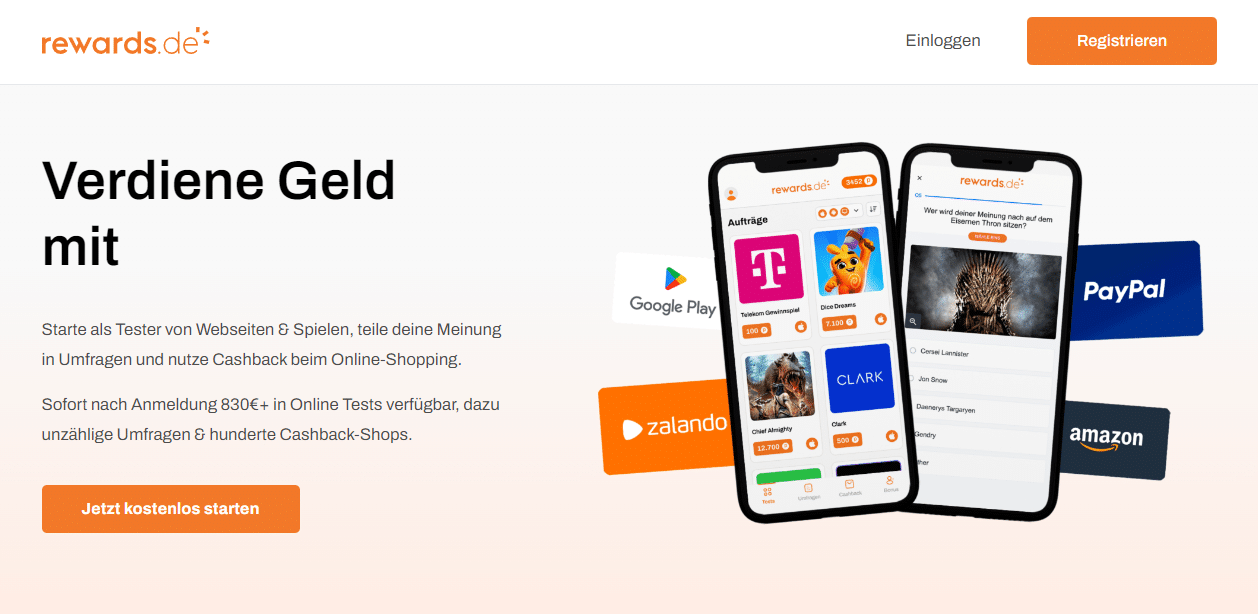
Rewards.de im Test: Was kann das junge Portal 2024?
Du willst deine Zeit vor dem Fernseher sinnvoll nutzen und ein bisschen Geld nebenbei verdienen, während die Flimmerkiste läuft? Die Online-Plattform Rewards.de will genau das …
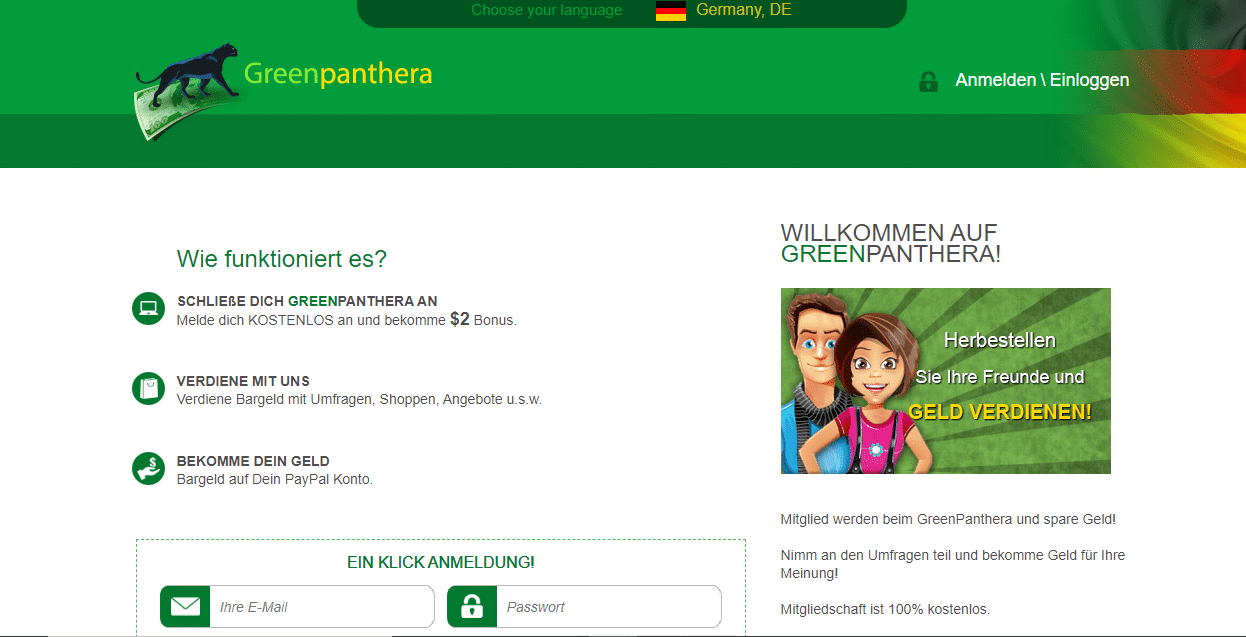
Greenpanthera im Test 2024: Meine Erfahrungen
Täglich bis zu zehn Umfragen beantworten und dadurch einen langfristigen Nebenverdienst aufbauen? Genau damit wirbt das internationale Umfrageportal Greenpanthera. Ob das letztlich wirklich möglich ist, …
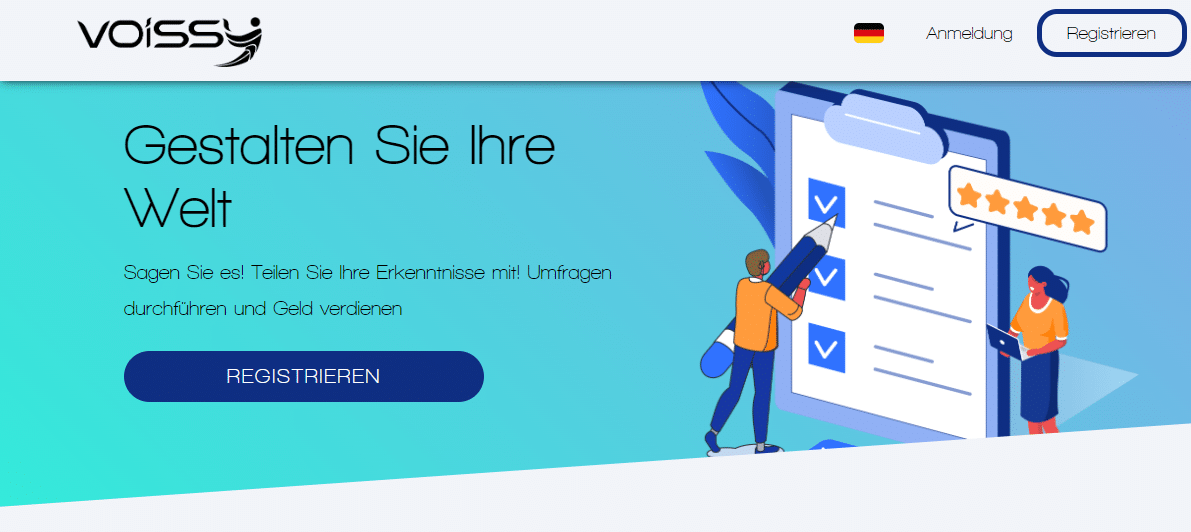
Voissy im Test: Meine Voissy Erfahrungen 2024
Frankreich, das Land der Romantik, der Côte d’Azur und der gehobenen Sterneküche, hat mit Voissy einen Neuling im Bereich der Online-Umfragen auf den internationalen Markt …
bizFM Insights
Online Umfragen
Das Prinzip ist eine Win-Win–Situation: Auch heutzutage ist es wichtig für ein Unternehmen zu wissen, wie sein Produkt auf dem Markt ankommt und was der Verbraucher darüber denkt. Um dies herauszufinden, beauftragen sie Umfrageinstitute, die mittlerweile das Internet dafür nutzen, die Meinung einer breiten Masse möglichst schnell und einfach zu überschauen. Diese Umfrageinstitute vergüten Ihre Teilnahme an ihren Umfragen, meist zunächst durch Sammeln von Punkten. Ab einem gewissen Wert kannst du dir diese Punkte dann in Euro auf dein Konto auszahlen lassen. Als grobe Orientierung gilt pro 10 Minuten Zeitaufwand erhältst du eine Vergütung von 1 €. Um mit diesen Online – Umfragen also dein Einkommen ein wenig aufzubessern, empfehlen wir, dich in mehreren Umfrageportalen zu registrieren und hier an verschiedenen Umfragen teilzunehmen. Bevor eine Umfrage für dich zur Teilnahme freigeschaltet ist, musst du meistens ein Umfrage-Panel durchlaufen, bei dem automatisch festgestellt wird, ob du auf Grund einer Daten die passende Person für die Umfrage bist. Auch der Durchlauf dieses Panels bedeutet meistens das Erzielen von Punkten, allerdings natürlich weniger als die Teilnahme an der eigentlichen Umfrage.
bizFM Check
Anbieter und Erfahrungen für Online-Umfragen
Swagbucks
Ein Portal mit vielen verschiedenen Möglichkeiten, online Geld zu verdienen, ist die Plattform swagbucks.
Hier kannst du nicht nur mit Umfragen Geld verdienen, sondern das Cashback-Programm nutzen, mit online Games Geld verdienen, für deine Internetsuchen belohnt werden und sogar Videos schauen und Geld verdienen. Geld gibt es aber auch, wenn du zum Beispiel an einem Produkttest teilnimmst. Die Auswahl ist groß und die Verdienstchancen wirklich hoch.
Die Anmeldung bei Swagbucks ist kostenlos.
Nach Registrierung sammelst du durch die Teilnahme an den angebotenen Aktivitäten Swagbucks /SBs).
Die Teilnahme an Testprogrammen wird mit ca. 200 SBs vergütet, für einen Testdownload einer App kann auch eine Vergütung von bis zu 650 SBs ausgeschrieben sein.
Ab 500 SB kannst du deine Punkte in Form von Gutscheinen (Amazon, iTunes, Zalando etc.) auszahlen lassen. Ab 899 SB kannst du die gesammelten Punkte auch auf den PayPal Konto auszahlen lassen.
Aber Achtung: PayPal Guthaben ist nicht gleichwertig mit Gutscheinen. Bei der PayPal Gutschrift erhältst du für 899 SB 5€. Bei Gutscheinen benötigst du für 5€ nur 500 SB. Es lohnt sich hier also eher auf Gutscheine zu setzen.
TrendsetterClub
TrendsetterClub ist eine weitere Umfragen-Plattform für Unternehmen.
Zunächst registrierst du dich mit Ihrer E-mail-Adresse und füllst einen Profil – Fragebogen aus. Du erhältst daraufhin Einladungen zu den Umfragen per Email und kannst dir aussuchen, an welcher Befragung du teilnehmen möchtest und welcher lieber nicht. Für jede erfolgreiche Teilnahme erhältst du Punkte, sogenannte TrendPoints, die du später gegen Prämien eintauschen kannst.
Du erhältst pro Teilnahme an einer Umfrage ungefähr 200 Punkte.
TrendsetterClub führt hauptsächlich reguläre Online-Umfragen durch, doch es werden grundsätzlich auch viele weitere Studienarten angeboten. In deinen Profileinstellungen kannst du frei wählen, zu welchen Sonderstudien du eingeladen werden möchtest.
Deine gesammelten Punkte kannst du ab einem Betrag von 2.500 Punkten gegen einen Amazon-Gutschein im Wert von 5 € eintauschen.
Seit Kurzem bietet TrendsetterClub auch die Auszahlung per Banküberweisung an. Ab 5.000 Punkten kannst du eine Auszahlung auf Dein Konto in Höhe von 10 € anfordern.
TrendsetterClub ist ein seriöses Umfrageportal, das seinen Mitgliedern Prämien für die Teilnahme an bezahlten Umfragen bietet.
MeinungsOrt Erfahrungen
Als Erstes registrierst du dich kostenlos mit deiner E-Mail-Adresse oder via Facebook-Login bei MeinungsOrt. Um möglichst viele passende Umfragen zu erhalten, füllst du einen Profil-Fragebogen aus. Du kannst selbst im Portal nach Umfragen suchen oder den per Email versandten Einladungen zu einer Umfrage folgen.
Auf MeinungsOrt.de gibt es Umfragen zu vielen Themen, wie Lifestyle und Gesundheit, um nur einige zu nennen. Die Länge der Umfragen variiert zwischen 5 und 15 Minuten.
Je nach Zeitintensität und Schwierigkeit bekommst du Punkte auf dein Mitgliederkonto gutgeschrieben. Diese Punkte kannst du dir dann unterschiedlich auszahlen lassen, als Gutschein oder als Barauszahlung. 1 Punkt entspricht dabei 0,05 Euro. Auf deinem Nutzerkonto benötigst du 50 Punkte, um eine Auszahlung beantragen zu können. Diese Punkte entsprechen einem Gegenwert von 2,50 Euro und sind für alle Auszahlungsarten gleich.
MeinungsOrt ist ein seriöses Panel, bei dem sich die Teilnahme grundsätzlich lohnt. Die deutschen Datenschutzrichtlinien werden auch bei diesem Anbieter befolgt, obwohl es keine Niederlassung in Deutschland gibt. Während der Umfragen werden alle Informationen verschlüsselt übertragen.
Testerheld Erfahrungen
Testerheld ist eine Plattform, auf der du als Produkttester Geld verdienst. Du findest dort Aufträge in vielen verschiedenen Kategorien. Es gibt Webseiten-Tests, Produkt-Tests, App-Tests und auch Spiele-Tests. Du hast hier die Möglichkeit neue (digitale) Produkte von großen deutschen Unternehmen zu testen und erhältst als Gegenleistung Geld. Zu den Kunden von Testerheld zählen zum Beispiel die Commerzbank, Lottoland und auch Amazon.
Die Anmeldung ist schnell, einfach und vor allem kostenlos möglich. Du benötigst lediglich eine gültige E-Mail-Adresse. Im Anschluss an die Registrierung kannst du sofort loslegen. In deinem Nutzerbereich findest du sofort nach der Anmeldung zwischen 15 und 20 Aufträgen. Wenn du einen Auftrag annimmst, bekommst du eine leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du bei deinem Test vorgehst.
Auch hier hängt dein Verdienst in erste Linie davon ab, wie viele Aufträge du annimmst und bearbeitest. Je aktiver, desto mehr Aufträge erhältst du.
Bereits direkt nach der Anmeldung stehen dir bis zu 20 Aufträge zur Verfügung. Innerhalb von wenigen Minuten kannst du bereits bis zu 10 Euro verdienen. Es gibt auch immer wieder einzelne Aufträge, für die du zweistellige Eurobeträge erhalten kannst. Wie viel du für den einzelnen Auftrag bekommst, ist auf dem Vorschaubild erkennbar. So kannst du einfach die am besten bezahlten Aufgaben aussuchen.
Pro Monat kannst du mit Testerheld mit gut 30 bis 50 Euro rechnen, wenn du regelmäßig Tests durchführst.
Nach Erfahrungsberichten tritt Testerheld als ein seriöses Unternehmen auf, das die Möglichkeit bietet, sich ein wenig dazu zu verdienen.
Myiyo Erfahrungen
Myiyo ist eine Plattform, auf der du an Umfragen teilnehmen kannst. Sie vergütet dir erfolgreich abgeschlossene Umfragen mit Punkten, die du dir auf dein PayPal-Konto auszahlen lassen kannst.
Myiyo ist ein beliebtes Meinungsportal, das zum weltweit tätigen Markforschungsunternehmen mo’web research gehört. Insbesondere die hohe Vergütung pro Umfrage und das Startguthaben machen die Plattform attraktiv. Auch die verfügbare Smartphone-App ist positiv hervorzuheben, da sie es erlaubt, unkompliziert von unterwegs an Umfragen teilzunehmen.
Grundsätzlich entsprechen 1000 Punkte einem Euro. Hast du 20.000 Punkte gesammelt, kannst du dir diese per PayPal auszahlen lassen. Die Auszahlungsgrenze liegt damit bei 20 Euro.
Myiyo kann vor allem mit seiner hohen Vergütung pro Umfrage und der an das Panel angeschlossenen Community überzeugen. Auch das Startguthaben, das du nach Ausfüllen Ihres Nutzerprofils erhältst, hinterlässt einen userfreundlichen Eindruck. Als Nachteil musst du in Kauf nehmen, dass du maximal 5 Umfragen pro Monat erhältst. Auf diese Weise kann es 2 oder sogar 3 Monate dauern, bis du die vergleichsweise hohe Auszahlungsgrenze von 20 Euro erreicht hast.
ipsos i say
I-Say bietet seinen registrierten Nutzern in erster Linie Umfragen an, mit denen du Punkte verdienen kannst. Wie viele Punkte du für eine Umfrage bekommst, hängt davon ab, wie umfangreich die Umfrage ist. Die Dauer der Umfragen liegt zwischen 10 und 15 Minuten. In der Regel verdienst du zwischen 5 und 250 Punkte je Umfrage.
Die regelmäßige Teilnahme lohnt sich zusätzlich durch das bei I-Say angebotene Loyalitätsprogramm. Hierbei erhältst du Bonus-Treuepunkte für die abgeschlossene Teilnahme an Umfragen. Für 5 Umfragen gibt es 25 Bonus-Treuepunkte. Wenn du 15 Umfragen erledigst, bekommst du schon 50 Bonus-Treuepunkte. Die Staffelung reicht bis zu 100 Umfragen, für die du 300 Punkte gutgeschrieben bekommst.
Die verdienten Punkte kannst du in Gutscheine einlösen. Es steht eine große Auswahl von Gutscheinen zur Verfügung, etwa von Amazon, Ikea, Otto, oder iTunes. Dabei ist die Einlösung der Punkte in einen Amazon-Gutschein am günstigsten. Bereits für 196 Punkte gibt es einen 2 Euro Gutschein der beliebten Shoppingplattform. Weitere Gutscheine sind für 500 Punkte mit einem Betrag von 5 Euro möglich. 100 Punkte entsprechen umgerechnet 1 Euro. Damit du die Gutscheine einlösen kannst, musst du mindestens 990 Punkte sammeln.
Eine Barauszahlung des Guthabens ist nur über eine virtuelle Prepaid Mastercard möglich.
Toluna Erfahrung
Mit dem Umfrageportal Toluna verdienst du nicht nur durch die Teilnahme an Umfragen Geld, sondern wirst Mitglied in einer Community.
Als Erstes registrierst du dich als Nutzer mit deiner gültigen E-Mail-Adresse kostenlos im Onlineportal von Toluna. Danach kannst du schon die ersten Belohnungspunkte sammeln, indem u die Profilumfragen ausfüllst. Für jede dieser Umfragen erhältst du 100 Belohnungspunkte und sorgst gleichzeitig dafür, dass die späteren Umfragen besser zu dir passen.
Toluna arbeitet mit großen namhaften Marken zusammen und bietet zahlreiche Umfragen zu Produkten, Dienstleistungen, Medien, Gesellschaft, Lifestyle und Politik.
Wie viele Punkte du tatsächlich bekommst, hängt davon ab, wie aktiv du in der Community bist und natürlich auch von der Anzahl der Umfragen, die du beantwortest. 4.000 Punkte entsprechen dabei 1 Euro. Es gibt:
- 500 Punkte als Willkommensgeschenk bei Registrierung
- 100 Punkte für jede Profilumfrage
- 15 bis 20.000 Punkte je Umfrage (abhängig von der Länge der jeweiligen Umfrage)
- 5.000 Punkte bekommst du, wenn du Gewinnspiele in der Community organisierst
- 1.000 Punkte bei der Erstellung von Inhalten
- 500 Punkte für die erfolgreiche Werbung eines Freundes
- 1.000.000 Punkte als Gewinn möglich bei der täglichen Millionär-Verlosung
Du entscheidest selbst, in welcher Form du Belohnungspunkte einlöst. Über das Belohnungscenter wählst du zwischen verschiedenen Gutscheinen, Gewinnspieltickets und Bargeld.
- Ab 40.000 Punkten bietet Toluna Gutscheine über 10 € z.B. für Zalando, Steam oder iTunes
- Für jeweils 500 Punkte kannst du täglich an der Toluna Millionär-Lotterie teilnehmen. Du bekommst die Chance, 1 Million Belohnungspunkte (derzeit 250 Euro) zu gewinnen. Die Teilnahme ist freiwillig.
- Ab 145.000 Belohnungspunkten kannst du dir Bargeld auszahlen lassen. Die Auszahlung erfolgt über Paypal und beträgt bei der genannten Summe an Punkten aktuell 35 Euro.
- Zum Teil ermöglicht Toluna auch die Spende deiner verdienten Belohnungspunkte. Toluna verdoppelt den Wert der Spende an die jeweilige Organisation
Wie bei den meisten Umfrage – Portalen kommt es auch bei Toluna vor allem darauf an, wie aktiv du an den Angeboten auf der Website teilnimmst. Je höher der Aufwand, desto schneller erzielst du die zu erreichenden Punkte.
mobrog Erfahrung
Mobrog ist eine seriöse Meinungsplattform, die zum deutschen Marktforschungsunternehmen Splendid Research gehört. Die Webseite ist simpel gehalten, so dass du dich schnell auf der Plattform zurechtfindest und Umfragen absolvieren kannst. Der Verzicht auf ein kompliziertes Punktesystem und die niedrige Auszahlungsgrenze von 5 Euro machen Mobrog in Sachen Bezahlung zu einem Top-Anbieter. Im Gegensatz hierzu steht jedoch die überdurchschnittlich hohe Screen-Out-Quote, sodass du geduldig sein musst, wenn du dich hier einen kleinen Nebenverdienst aufbauen möchtest.
Zunächst lädt dich das Portal per E-Mail zu Umfragen ein. Du entscheidest dann, ob du daran teilnehmen möchtest. Ein großer Teil der Umfragen dreht sich um die Bewertung von Produkten oder Produktgruppen. Daneben kann es auch sein, dass du dich zu Trends und neuen Werbespots äußern sollst. Je nach Umfang der Umfrage erhältst du eine Vergütung. Im Durchschnitt dauert eine Umfrage rund 15 Minuten. Im Gegensatz zu anderen Portalen sammelst du mit dem erfolgreichen Abschluss von Umfragen keine Punkte, sondern bekommst direkt Geld in deinem Mobrog-Account gutgeschrieben.
Bei regelmäßiger Teilnahme an Umfragen über einen längeren Zeitraum kannst du deinen Status verbessern und Medaillen sammeln. Bist du zum Premium-User aufgestiegen, erhältst du:
- mehr Umfragen,
- eine höhere Vergütung und
- die Möglichkeit, öfter an Telefoninterviews und Produkttests teilzunehmen.
Hast du insgesamt 5 Euro in deinem Account zusammen, kannst du dir das Geld über PayPal oder Skrill auszahlen lassen.
Meinungsstudie Erfahrungen
Nach einer kostenlosen Anmeldung auf Meinungststudie.de kannst du direkt loslegen und an Umfragen teilnehmen. Das Portal ist nutzerfreundlich gestaltet. Auf einen Blick findest du verfügbare Umfragen. Diese erhältst du überwiegend jedoch per E-Mail. Weiterhin erfährst du in der Email, wie lange du für die jeweilige Umfrage ungefähr brauchst.
Je detaillierter du dein Profil ausfüllst, desto mehr passende Umfragen erhältst du. Meinungsstudie versendet zwischendurch auch immer wieder Kurzumfragen, damit dein Profil auf aktuellem Stand bleibt.
Als kleine Motivationshilfe bietet Meinungsstudie auch ein Status-Abzeichen an, welches du zusätzlich zu den Prämienpunkten verdienen kannst. Mit dem Ausfüllen der Profilfragebögen und jeweils einer bestimmten Anzahl von Umfragen kannst du einen neuen höheren Status bekommen. Anfänger erhalten das Bronze-Abzeichen, das höchste Abzeichen ist Diamant.
Für die Teilnahme an den Umfragen erhältst du Prämienpunkte auf deinem Nutzerkonto gutgeschrieben. Die Umfragedauer liegt zwischen 15 und 20 Minuten. Je nach Art und Umfang der Umfrage kannst du bis zu 7 Euro pro Umfrage verdienen. Das ist – verglichen mit anderen Anbietern in dem Bereich – ziemlich gut, auch wenn nicht jede Umfrage so hoch vergütet wird.
Deine verdienten Prämienpunkte kannst du in Form von elektronischen Gutscheinen oder Papiergutscheinen einlösen. Dies ist abhängig davon, welchen Gutscheinanbieter du auswählst. Zur Auswahl stehen unter anderem Amazon, Zalando, iTunes, Ikea und Obi.
Ab einem Wert von 20 Euro kannst du einen Gutschein erhalten. Die Auszahlung von Bargeld ist bei Meinungsstudie nicht möglich.
Meinungsstudie ist ein seriöses Unternehmen. Der Anbieter ist bereits seit 2004 am Markt aktiv und Mitglied bei verschiedenen Marktforschungs-Dachverbänden (z.B. ESOMAR). Die Mitgliedschaft verpflichtet das Panel sich nach einem professionellen Verhaltenskodex zu richten. Nach eigenen Angaben zählt das Portal über 3 Millionen Mitglieder.
Entscheiderclub Erfahrungen
Bei Entscheiderclub.de treffen bekannte Meinungsforschungsinstitute und Unternehmen auf Menschen, die gerne an bezahlten Online-Befragungen teilnehmen.
Damit du an Umfragen beim Entscheiderclub teilnehmen kannst, ist eine kostenlose Registrierung erforderlich. Hierfür benötigst du eine E-Mail-Adresse oder du registrierst dich via Facebook- oder Google-Login.
Nach dem ersten Login füllst du am besten dein Profil vollständig aus, um bald passende Umfragen zu erhalten. Die Einladung zu den Umfragen erfolgt per E-Mail. Für dich bereitgestellte Umfragen findest du zusätzlich auch in deinem Nutzerbereich.
Bevor du an einer bezahlten Umfrage teilnimmst, findest du in der Einladungs-E-Mail Angaben über die Dauer und deinen Verdienst. Schnell sein lohnt sich, denn teilweise ist die Teilnehmerzahl je Umfrage stark begrenzt. Am besten erledigst du die Umfrage noch am Tag der Einladung.
Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Entscheiderclub selbst sagt, dass so jeder die gleichen Chancen hat. Du erhältst zwischen 5 und 7 Umfragen im Monat. Diese Zahl variiert, je nachdem, zu welcher Zielgruppe du gehörst. Im Schnitt bekommst du für eine Umfrage zwischen 0,50 Euro und 2,50 Euro. Dies ist abhängig von der Länge und wie umfangreich die Befragung ist.
Als einer der wenigen Anbieter musst du bei Entscheiderclub dein Guthaben nicht anfordern. Eine Auszahlung erfolgt automatisch, sobald du im Monat mindestens 10 Euro erreicht und deine Bankverbindung im Profil hinterlegt hast. Die Gutschrift erfolgt dabei immer zu Beginn des Folgemonats.
Betreiber von Entscheiderclub.de ist die GapFish GmbH mit Sitz in Berlin. Die Gesellschaft ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz aktiv.
Die Mitgliedschaft im Bundesverband deutscher Markt- und Sozialforschung (BVM) und bei der Deutschen Gesellschaft für Online-Forschung e.V. (DGOF) sprechen für einen professionellen Umgang mit Kunden, Mitgliedern und deren Daten und somit für die Seriosität des Entscheiderclubs.
bizFM Tipps
Online-Nebenjob
Ghost-Writer, Übersetzer, Texter – nur drei Begriffe, wie die angebotenen Nebenjobs im Internet bezeichnet werden. Auf Anzeigen – Portalen werden jeden Tag -zig Jobangebote eingestellt und aktualisiert. Hier wird jedermann fündig. Allerdings ist bei solchen Angeboten Vorsicht angesagt: Betrüger schrecken vor nichts zurück und scheuen sich nicht, deinen Namen und deine Daten für ihre Zwecke zu nutzen. Beachte daher die folgenden Tipps, um unseriöse Angebote zu identifizieren:
- Du sollst für etwas in Vorkasse gehen
- Du findest viele Versprechen, aber keine Beschreibungen
- Der Anbieter wirbt mit Prüfsiegeln, die es nur auf seiner Seite gibt
- Der Anbieter ist nur telefonisch und auch nur mobil erreichbar
- Es werden viele lobende Stimmen genannt, die nicht nachprüfbar sind
- Das Impressum ist unvollständig; Bezeichnung der Firma und Adresse fehlen
Cashback Apps
Mit Apps Geld verdienen - Erfahrungen
Natürlich bieten die meisten Portale, um Geld zu verdienen, ihr Geschäftsmodell nicht nur als Website an. Oftmals gibt es auch eine passende App, damit du von überall arbeiten kannst. Die gängigsten App-Modelle sind dabei:
- Online Umfragen
- Produkttest
- Mikrojobs
- Cashback
Online Umfragen und Produkttests funktionieren genau so, wie bereits oben beschrieben, Cashback-Programme hingegen funktionieren so, dass ein Kunde für Werbungs-Aufwand (zum Beispiel eine Empfehlung an Freunde oder Bekannte) Provision erhält. Dabei bedeutet „Mikrojob„, dass dir auf einer App kurzzeitige Aufgaben in deiner Umgebung angezeigt werden, die du ausführen kannst, um damit kleine Beträge zu verdienen.
bizFM Tipps
Möglichkeiten online Geld zu verdienen
Produkttester
Neue oder bestehende Produkte ausgiebig zu testen und das Ganze auch noch gegen Bezahlung ist durchaus reizvoll. Oftmals darfst du zusätzlich das Testprodukt behalten. So kannst du dazu beitragen, Produkte zu verbessern und anderen die Kaufentscheidung zu erleichtern.
Zunächst meldest du dich bei einem Produkttester–Portal an. Die Anmeldung und Teilnahme an den Tests ist völlig kostenlos. Es besteht die Möglichkeit, entweder Produkte zu testen (hierzu benötigen Sie meist einen Amazon – Account), oder Websites und Apps.
Nach dem Testen schreibst du einen kurzen Bericht oder bewertest das getestete Produkt und erhältst hierfür eine Aufwandsentschädigung von ca. 5 bis 10 Euro pro Auftrag. Bei Webseiten und Apps liegt die Vergütung pro Test bei etwa 1 bis 10 Euro.
Je nachdem, für wie viele Aufträge du dich anmeldest, hast du durchaus die Möglichkeit, 100 bis 200 Euro pro Monat dazu zu verdienen. Außerdem verlangen die Unternehmen die zu testenden Produkte nur in den seltensten Fällen nach dem Test zurück.
Plasma spenden für Geld
Eine weitere Möglichkeit, an Geld zu kommen, ist die Spende von Plasma. Hierbei kannst du zwar nicht online Geld verdienen, aber du solltest dich vorab ausführlich online informieren.
Die Plasmaspende ist eine moderne und schonende Form der Blutspende. Hierbei spendest du nur den flüssigen Teil deines Blutes, die zellulären Blutbestandteile, wie zum Beispiel rote Blutkörperchen, behältst du. Möglich macht dies eine spezielle Technik – die Plasmapherese. Sie entnimmt dein Blut, trennt es in der Maschine in Blutplasma und Zellbestandteile des Blutes auf und gibt dir die Zellen zurück. Dies geschieht in drei bis vier Zyklen – bis die gewünschte Menge Plasma erreicht ist. Plasma kann so viel häufiger gespendet werden, als Blut, da dein Körper nach der Plasmaspende nur den flüssigen Teil deines Blutes wiederherstellen muss.
Spenden kannst du, wenn du über 18 Jahre alt bist, mindestens 50kg wiegst und gesund bist. Weiterhin musst du einen festen Wohnsitz haben und darfst keine Drogen nehmen.
Wenn du Mehrfach-Spender wirst, dann darfst du im Abstand von 2 spendenfreien Tagen bis zu 60 Mal innerhalb eines Jahres spenden.
Die Spende von Blut, Blutplasma oder anderen Blutbestandteilen ist in Deutschland grundsätzlich freiwillig und unentgeltlich. Nach § 10 Transfusionsgesetz kann pro Spende jedoch eine finanzielle Aufwandsentschädigung gewährt werden. Diese ist ausdrücklich keine Bezahlung der Spende an sich.
Mit Twitter Geld verdienen
Twitter ist eines der mächtigsten Werkzeuge im Social Media geworden. Den Kurznachrichtendienst nutzen mittlerweile über 100 Millionen Menschen. Im Normalfall werden kleine Status-Updates versendet oder es wird die aktuelle Meinung zu einem bestimmten Thema getwittert.
Klar, dass bei dieser Masse an Nutzern auch viele findige Unternehmer auf interessante Ideen gekommen sind wie man mit Twitter Geld verdienen kann. Überall dort, wo sich viele Menschen tummeln, gibt es immer auch Möglichkeiten schnell Geld zu verdienen. Dabei hast du ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten wie du an dieses Thema herangehen kannst.
Wie auch bei anderen SocialMedia – Plattformen ist aber auch bei Twitter zunächst die Basis: Follower haben. Menschen, die dir auf deinem Twitter-Account folgen, deine Beiträge lesen und diese weiterverbreiten.
Dies kannst du bei Twitter automatisieren: Mit dem Twitter-Tool Tweetadder schaffst du es, innerhalb weniger Tage einen mächtigen und zielgruppenspezifischen Twitter-Account aufzubauen.
So ist es zum Beispiel möglich Twitter nach gewissen Keywords zu durchsuchen und den Urhebern dieser Tweets dann automatisch zu folgen. So folgen dir viele interessante Twitterer zurück, mit denen man sich vernetzen kann. Neben automatischen Follow- und Unfollow-Funktionen können mit der Software Tweetadder auch sämtliche Aktivitäten automatisiert werden. So kannst du beispielsweise Tweets vorprogrammieren, die dann nach und nach getwittert werden. Das ist besonders interessant für potentielle Werbepartner, mit denen schließlich Geld verdient werden möchte. Es ist ganz einfach möglich eine Reihe an Tweets zu bestimmten Zeiten automatisch zu twittern. Mit dem Tweet Generater, der mit Hilfe von Synonymen aus einem Tweet eine ganze Reihe unterschiedlicher Tweet erstellen kann, bringst du obendrein noch ein wenig Abwechslung in die Tweets.
Wenn du es mit Hilfe von Tweetadder geschafft hast, dir einen Account aufzubauen, der für Werbepartner interessant ist, dann kann es endlich losgehen. Es gibt zahlreiche Anbieter, die eine Art Tweet-Tauschbörse betreiben. Hier suchen Unternehmer starke Twitter-Accounts, auf denen Werbung in Tweets geschaltet werden kann. Je nach Stärke des Accounts können die Einnahmen zwischen ein paar Cent und mehreren Dollar pro Tweet liegen.
Eine weitere Möglichkeit mit Twitter ein bisschen nebenbei zu verdienen besteht darin, Affiliate-Links in Tweets zu platzieren. Damit bewerben Sie gezielt Produkte, welche die Zielgruppe, also die eigenen Follower, interessant finden könnten. So kannst du dir mit der Provision ein kleines Taschengeld dazu verdienen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit des Direktmarketings mit seinem Twitter-Account. Du kannst zum Beispiel Annoncen bei Ebay schalten und dort Werbetweets verkaufen. Hier sollten der Kreativität einfach mal keine Grenzen gesetzt werden.
Stockfotos verkaufen
Bei diesem Tool machst du ein Foto und lädst es auf einer Plattform hoch. Werbeagenturen und Website-Betreiber können auf dieser Plattform aus einem Portfolio Bilder aussuchen, die sie auf Ihren Seiten gegen einen Kostenaufwand nutzen. Was aber gilt es besonders zu beachten, wenn du deine Fotos auf diesen Plattformen anbieten möchtest? Wir erklären es:
- Meist reicht zum Fotografieren eine gute Smartphone – Kamera aus. Allerdings gilt, wie in den meisten Fällen: Je besser die Qualität der Fotos, desto höher ist die Chance, dass dein Foto aus der angebotenen Masse heraus ausgewählt wird.
- Nimm dir ruhig die Zeit, das Foto nachzubearbeiten, bevor du es hochlädst. Jede Art der Qualitätssteigerung erhöht deinen Erfolg.
- Wenn du dein Bild hochlädst, wird dies auf den meisten Plattformen entweder unter einem bestimmten Schlagwort oder in einer Kategorie geführt. Achte darauf, dass der Titel deines Bildes also passend und zugleich möglichst allgemein gehalten ist, damit es bei möglichst vielen Suchbegriffen mit unter der Auswahl erscheint.
- Du erhältst für den einzelnen Download deines Fotos lediglich Cent-Beträge. Um also mit Ihren Bildern einigermaßen zu verdienen ist es also notwendig, dass entweder dein Foto möglichst häufig herunter geladen wird, oder aber dass du möglichst viele Fotos zu unterschiedlichen Themen zum Download anbietest.
Twitch Geld verdienen
Ähnlich wie YouTube bietet auch Twitch mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, die eigenen Inhalte direkt über die Plattform zu monetarisieren. Dabei gibt es ein 2-Stufen-Modell: Streamer mit einer gewissen Reichweite beginnen als Affiliates und können bei entsprechendem Wachstum ihres Kanals zu Partnern aufsteigen.
Bits sind sozusagen die Eigenwährung auf Twitch und können für echtes Geld von den Zuschauern erworben werden, um ihre Stars im Stream anzufeuern. Diese erhalten pro Bit 1 Cent. Für 100 Bits zahlt der Zuschauer (zum Zeitpunkt des Verfassens) 1,47 €.
Twitch ist eine Plattform, die hauptsächlich für das Streaming von Gaming-Inhalten bekannt ist. Passend dazu bietet Twitch Affiliates die Möglichkeit, Spiele oder kostenpflichtige Extrainhalte für diese (In-Game-Käufe) im Stream zu bewerben. Für jeden Verkauf erhält der Streamer dann eine Provision.
Partner können an den gezeigten Werbeanzeigen auf ihrem Kanal mitverdienen und selbst bestimmen, wie oft und wie lange sogenannte Mid-Roll-Einblendungen während des Streams gezeigt werden.
Wie viel du letztlich mit Twitch verdienen kannst, hängt maßgeblich von der Größe des Publikums, deren Interaktionsfreudigkeit und der Art der Monetarisierung ab.